





































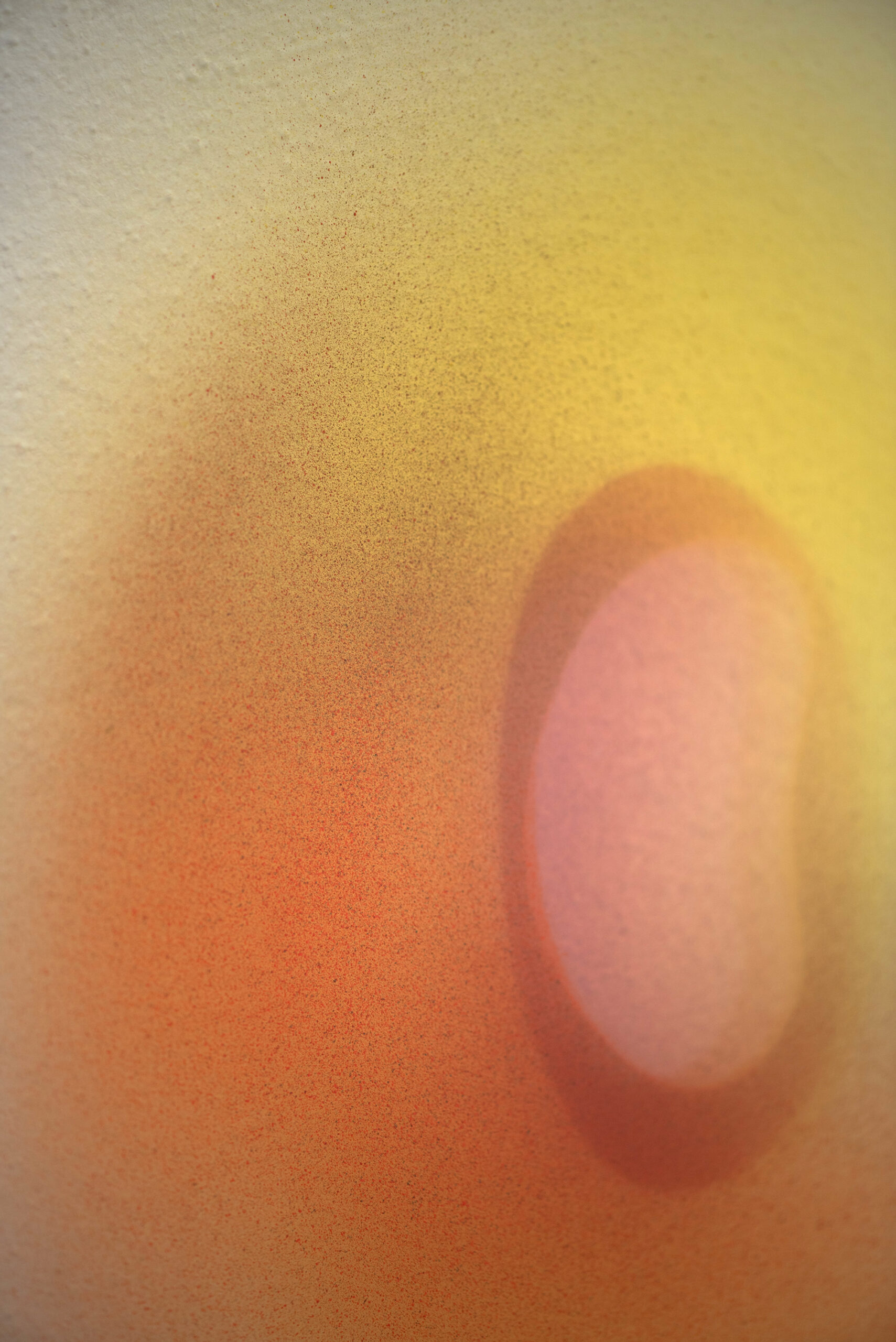
Lea Grebe
INVASIV THOUGHTS
Das melodische Zirpen der Grille wurde vor allem in China ab dem sechsten Jahrhundert sehr geschätzt. Zu dieser Zeit wurden diese Insekten daher dort in Käfigen gehalten. Sie standen nachts oft direkt neben dem Bett, damit Halter:innen zum Gesang der Grillen einschlafen konnten. Es ist anzunehmen, dass zuerst von kaiserlichen Hofdamen versucht wurde, Grillen derart zu domestizieren. Davon ausgehend ist diese spezielle Form der Insektenliebe zu einer Gelehrtenbeschäftigung avanciert, denen die melodischen Langfühlerschrecken als Sujet für Gedichte, Erzählungen und wissenschaftliche Studien dienten. Für Grillen entstand dabei eine Vielzahl an Ausstattungsgegenständen: Futtertabletts, Reinigungsbürsten, Pinzetten und Schlafnetze aus Seide staffierten die Behausungen der Tiere aus. Dickwandige Behälter aus getrocknetem Kürbis, oft mit kunstvollen Gravuren versehen, hielten die Grillen in der kalten Jahreszeit warm. Sommerkäfige bestanden hingegen aus einem Keramikkorpus, meist mit einem Gitternetz aus Holz. Um die Grillen zum Singen zu animieren, stimulierten die Besitzer:innen das jeweilige Insekt mit einem Haar aus Rattenbart, partiell gefasst in Elfenbein.
In Mitteleuropa entstanden bis ins 18. Jahrhundert spezielle Insektenmöbel – jedoch programmatischerer Natur als jene, die die Grillen behausten: etwa sogenannte Bienenstühle. Dabei handelte es sich um hölzerne Schränke oder Truhen, in die mehrere Bienenstöcke integriert waren. Sie erinnerten mit ihren Türen, kleinen Schubladen und dekorativen Elementen – etwa figürliche Deckelschnitzereien und -bemalungen – bewusst an Möbelstücke, sollten sie sich doch in das häusliche und meist bäuerlich geprägte Ensemble einfügen. Ziel war die praktische Haltung von Bienen im Wohnhaus, geschützt vor Kälte und Raub. Den illustren Stellenwert der Käfige chinesischer Grillen haben derlei Insektenmöbel indes nicht mehr erreicht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Insekten im europäischen Kulturraum weniger der Kontemplation – etwa als eine Art lebendiges Singspiel – dienten, sondern als Nutztiere betrachtet wurden: So standen in Mitteleuropa vor allem Honig, Wachs und die Bestäubungsleistung der Bienen für Privathaltung im Vordergrund. Insekten blieben so nicht nur integraler Teil ökologischer Systeme, sondern wurden auch als Part landwirtschaftlicher Ökonomie begriffen.
Sowohl die chinesischen Käfigmöbel für Grillen als auch die europäischen Bienenmöbel sind Beispiele für eine Kultur, die Insekten aus verschiedenen Nutzungsgründen einen Platz im häuslichen Leben einräumte und ihnen dafür eigens Möbel zuwies, die die Tiere ebenso schützten wie einkastelten. Mit Beginn der Industrialisierung verloren diese Praktiken nahezu gänzlich an Bedeutung und das Insekt wurde – ohne größeren kontemplativen oder ökonomischen Mehrwert für den Einzelnen – im privaten Raum vollends zum Schädling hochstilisiert, der größtenteils bekämpft wurde: ein Bild, das sich bis heute erhalten hat. Genannte historische Objekte, die dazu dienten, Insekten zu behausen, muten derzeit folglich wie stille Zeugen einer vergangenen und bisweilen befremdlichen Nähe und Neugier gegenüber Insekten an.
Indirekt zählen zu den exemplarisch genannten Möbeln auch die hier von Lea Grebe ausgestellten Hängeschränke des mittleren 19. und frühen 20. Jahrhunderts – häufig aus Nussbaum, Eiche oder Kirschholz gefertigt. Sie spiegeln den bürgerlichen Haushalt als repräsentativen und zugleich schützenden Raum wider. Ihre geschlossenen Korpusse fungierten ehemals als Schutzbehältnisse für Arzneien, Porzellanfiguren, Schmuckbände, Silber- und Zinnbecher, Devotionalien und andere Wert- und vor allem Schaugegenstände. Gerade im bürgerlichen Biedermeier und im Historismus war es zudem sehr beliebt, Käfer- und Faltersammlungen, getrocknete Pflanzen und andere vermeintliche Kuriositäten in Kabinettschränken oder Schauvitrinen aufzubewahren und darin zur Schau zu stellen. Diese Möbelstücke waren speziell dafür gedacht, Präparate hinter Glasfronten sichtbar und geschützt als Seltenheiten, aber auch als Ausweise eines neuerlich breiten wissenschaftlichen Interesses an Naturkunde zu präsentieren.
Als wären genannte Schränke nicht nur historische Objekte, sondern buchstäblich selbst längst der Zeit anheimgefallen, werden diese vermeintlichen Schutzräume für Insekten nun zur Heimstätte neuer Organismen – doch unter umgekehrten Vorzeichen: Die von Grebe aufgehängten Schränke beherbergen nun keine entomologische Sammlung im herkömmlichen Sinne mehr, sondern sind vielmehr von deren scheinbar vitalisierten Exponaten in Besitz genommen worden. Holzbesiedelnde Pilze und Galläpfel erobern die Korpusse zurück, setzen sich gar parasitär an ihnen fest; Tagfalterpuppen hängen daran und andernorts sprießt Efeu aus dem Putz. In metallische Dauerformen überführt, besetzt eine ganze Horde randständiger Flora und Fauna die hier ausgestellten Möbel und bricht aus den Wänden des Ausstellungsraums. Dabei ist vor allem das Material entscheidend, aus dem sie gegossen sind: Bronze. Als Legierung aus Kupfer und Zinn gehört sie zu den kulturhistorisch ältesten intentional hergestellten Werkstoffen und ihre Entdeckung im vierten Jahrtausend vor Christus markiert eine Zäsur, die in der Archäologie als Beginn der Bronzezeit bezeichnet wird. Neben Werkzeugen und Waffen ist Bronze seither ein bevorzugtes Material für figürliche und ornamentale Kunst. Der Einsatz der Legierung reichte von kleinformatigen Statuetten der altägyptischen und kykladischen Kulturen bis zu den heroischen Monumentalskulpturen der griechischen Klassik und den fein ziselierten Plastiken der Renaissance. Noch in die Gegenwart wird der Werkstoff für seine Dauerhaftigkeit, Korrosionsresistenz und die Fähigkeit geschätzt, feinste Details eines Ausgangsgegenstandes über einen Wachsausschmelzprozess metallisch bewahren zu können.
Durch den Einsatz von Bronze zur Darstellung von Kerbtieren und Myzeten invertiert Grebe die traditionsreiche Geschichte der Legierung: Was bisher oft einer anthropomorphen und idealisierenden Wirkung verpflichtet schien, wird durch ephemere, bisher kaum adäquat geschätzte, doch biologisch hochspezialisierte Strukturen vorgeblich unscheinbarer Wesen ersetzt. Und wo mit Bronze seit Jahrtausenden heroische Figuren, Götterbilder und symbolisch aufgeladene Ornamente geschaffen wurden, werden nun fragile, vormals kurzlebige Organismen auf Dauer konserviert. Das organische Original – etwa die Puppe eines Tagfalters, der nicht geschlüpft ist – tauscht im Gussprozess seinen Platz mit einem weitaus langlebigeren metallischen Medium. Der Abguss von Insekten, ihren Larven, von Pilzen, Blättern und Galläpfeln lenkt besagte tradierte Vorstellungen über den aufwendigen Einsatz von Bronze nicht nur kontextuell, sondern auch ästhetisch in eine neue Richtung: Anders als etwa in den Gestaltungsformen des frühen 20. Jahrhunderts werden von Grebe Pflanzen und Pilze nicht als Ornamentmotive in Metall und Glas übertragen oder abstrahiert, sondern eins zu eins und mit all ihrer Kreatürlichkeit erhalten. Die Hierarchie zwischen dem vermeintlich Erhabenen und dem offensichtlich Marginalisierten wird zumindest für einen kurzen Augenblick fadenscheinig. Umgekehrt werden menschengemachte Möbel nun von Organismen bevölkert, deren biologische Signatur allein als metallisches Zitat weiterexistiert. So entsteht ein komplexes Werkgefüge, das gleichermaßen in der Geschichte der Materialästhetik, in der Möbel- und Wohnkultur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, in der Naturgeschichte von Insekten, Gewächsen und Pilzen und in den gegenwärtigen Strategien der Ökologisierung von Wissen, auch in den Künsten, wurzelt. Durch die von Grebe intendierte Wechselseitigkeit zwischen ‚naturalia‘ und ‚artificialia‘ wird so – an den Rändern eines vermeintlichen Natur-Kultur-Dualismus – sichtbar, dass kulturelle und biologische Geschichten nicht nur nebeneinander existieren, sondern existenziell verwoben sind.
Michael Klipphahn-Karge
Installation views






Artist
Lea Grebe
Lea Grebe (*1987, Munich) studied Art Education, Art History, and Modern German Literature at Ludwig-Maximilians-Universität Munich (2007–2012). From 2012 to 2018, she studied Painting and Graphics under Prof. Axel Kasseböhmer at the Academy of Fine Arts Munich, graduating in 2018 as a master student. Since 2017, she has been working as an artistic associate in the class of former Prof. Kasseböhmer and later Prof. Schirin Kretschmann. Among other honors, she has received the Debutant Award of the City of Nuremberg, a working grant from the Kunstfonds Foundation, and the Bavarian State Scholarship for the Cité des Arts in Paris.
Works
If you are interested, please inquire about availability


